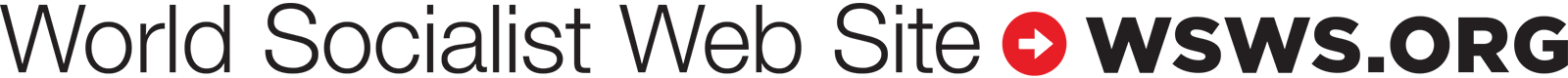Die jüngsten Entwicklungen am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, einem der weltweit renommiertesten Institute seiner Art, stellen eine große Gefahr für die Zukunft der Geschichtswissenschaft und die Holocaust-Forschung dar.
Nach der Emeritierung von Professorin Gertrud Pickhan, unter deren Leitung der Geschichtslehrstuhl des Instituts einen in Deutschland einzigartigen Schwerpunkt auf polnisch-jüdische Geschichte und die Verbrechen des Nationalsozialismus hatte, wurde Robert Kindler auf den Lehrstuhl berufen. Kindler ist ein Ziehsohn des rechtsradikalen Professors Jörg Baberowski, der bereits an der Humboldt-Universität Berlin einen extremen Rechtsschwenk durchgesetzt hat.
Robert Kindler hat unter Baberowski zur Hungersnot in Kasachstan promoviert und sein zweites Buch zur Jagd auf Seerobben im Russischen Reich geschrieben. Neben Kindler ist nun auch Martin Wagner am Osteuropa-Institut. Er hat ebenfalls unter Baberowski promoviert und zusammen mit ihm das Buch „Crises in Authoritarian Regimes. Fragile Orders and Contested Power“ herausgegeben. Wagner nahm zudem im Jahr 2020 gemeinsam mit Baberowski an einem Workshop an der Princeton University in den USA zum Projekt „From Totalitarian to Authoritarian Rule“ teil, das von Baberowski und der Princeton-Professorin Deborah Kaple geleitet und von der Princeton University mit stolzen 300.000 US-Dollar unterstützt wurde.
Mit der Übernahme des Lehrstuhls durch Kindler hat eine radikale Umorientierung eingesetzt. Unter seiner Leitung wurde der gesamte Schwerpunkt am Institut zerschlagen, der sich auch in der Themenwahl von Doktorarbeiten niederschlug, die von Pickhan betreut wurden. Nach nur einem Jahr ist kein einziger der vorherigen Mitarbeiter des Lehrstuhls noch am Osteuropa-Institut beschäftigt.
Statt Kursen zur polnisch-jüdischen Geschichte, zur Geschichte Polens und zum Holocaust bietet das Osteuropa-Institut nun ausschließlich Seminare an, die im Zeichen der deutschen Außenpolitik und ihrem erneuten Drang nach Osten stehen. So bietet Kindler Seminare mit Titeln wie „Energy Empires. Verflechtungen, Ressourcen und Konflikte in Osteuropa“ und „Orte der Repression. Sowjetische Speziallager in Deutschland, 1945-1950“ an.
Martin Wagner bietet Kurse wie „Geschichte ist Gegenwart. Staat und Nation in der Ukraine“ an. Ganz im Sinne der imperialistischen Kriegspolitik gegen Russland, die als zentrales Element das Schüren nationaler und ethnischer Konflikte wie in der Ukraine umfasst, legt das Osteuropa-Institut nun auch einen Schwerpunkt auf die Nationalitätenfrage in Russland und der ehemaligen Sowjetunion.
Die weitreichenden Implikationen der Vorgänge an der FU können nur vor dem Hintergrund der enormen Verbrechen des Nationalsozialismus in Polen und der wenig ruhmreichen Geschichte von deren Erforschung und der Holocaust-Forschung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verstanden werden.
Im Zweiten Weltkrieg war das nationalsozialistisch besetzte Polen der zentrale Schauplatz der industriellen Vernichtung des europäischen Judentums. Alle Vernichtungslager, von Auschwitz bis Treblinka und Sobibor, lagen im heutigen Polen. Bis zum Holocaust war Polen die Heimat der größten jüdischen Bevölkerung der Welt, die auf 3 bis 3,5 Millionen Menschen geschätzt wird. Von ihnen wurden 90 Prozenten von den Nazis ermordet. Hinzu kamen Millionen nicht-jüdische polnische Zivilisten, die ebenfalls dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen.
Mit einigen wenigen rühmlichen Ausnahmen scheuten deutsche Historiker nach dem Zweiten Weltkrieg eine eingehende Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, vor allem mit dem Massenmord an der jüdischen Bevölkerung Europas und dem Vernichtungskrieg der Nazis in Osteuropa.
Die ersten grundlegenden Werke zum Holocaust wurden in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg alle außerhalb Deutschlands und fast ausschließlich von Überlebenden des Holocaust geschrieben. Besonders hervorzuheben ist dabei „Die Vernichtung der europäischen Juden“ von Raul Hilberg, der vor den Nazis aus Österreich geflohen war und sein Werk zur Geschichte des Holocaust in den 1950er Jahren in den USA schrieb. In Deutschland wurde sein Buch, das 1961 erstmals auf Englisch erschien, erst nach langem Widerstand großer Verlage 1982 in dem kleinen Berliner Verlag Olle & Wolter veröffentlicht.
Andere maßgebliche Arbeiten von Holocaust-Historikern aus Polen, die den Holocaust und das Leben des polnisch-jüdischen Bevölkerung noch während des Krieges oder in der Nachkriegszeit vorwiegend auf Jiddisch dokumentierten und analysierten – zu nennen ist hier insbesondere der 1944 ermordete sozialistische Historiker Emanuel Ringelblum –, wurden bis heute nicht ins Deutsche übersetzt.
Gertrud Pickhan war eine der ersten in Deutschland, die sich nach dem Historikerstreit der späten 1980er Jahre einem ernsthaften Studium der polnisch-jüdischen Geschichte zuwandte. Im Historikerstreit hatte der rechtsradikale Historiker Ernst Nolte, ein Vorbild Jörg Baberowskis, vergeblich versucht, eine weitreichende Legitimierung der Verbrechen des Nationalsozialismus zu erreichen.
Eine besondere wissenschaftliche Leistung ist Pickhans Buch „Gegen den Strom. Der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund ‚Bund‘ in Polen 1918-1939“ aus dem Jahr 2001. Basierend auf umfassender Quellenforschung im Polnischen, Jiddischen und Deutschen zeichnet sie ein nuanciertes Bild der oft widersprüchlichen Politik des polnischen-jüdischen sozialdemokratischen Arbeiterbundes in der Zwischenkriegszeit.
Der Bund brach bereits 1903 mit den Bolschewiki Lenins. Seine Entwicklung in der Zwischenkriegszeit stand aber gleichwohl unter dem Einfluss der russischen Oktoberrevolution von 1917, die er in den 1920er und 1930er Jahren auch gegen die schlimmsten Verbrechen Stalins, die Moskauer Prozesse, vehement verteidigte.
Andere Arbeiten Pickhans beschäftigten sich unter anderem mit der Geschichte des russischen Nationalismus und der russischen Kunst.
Pickhan übernahm 2004 die Leitung des Arbeitsbereichs für Geschichte am Osteuropa-Institut. Es ist vor allem ihrem Einsatz zu verdanken, dass der Arbeitsbereich internationale Anerkennung fand und Pionierarbeit in der Erforschung der Geschichte des polnischen Judentums leistete.
Im Gegensatz zu fast allen anderen Lehrstühlen an deutschen Universitäten, die sich mit der Geschichte des Holocaust beschäftigen, wurde am Osteuropa-Institut nicht nur zur Ermordung, sondern auch zum reichen politischen und intellektuellen Leben des polnischen Judentums vor dem Holocaust – darunter auch in Deutschland – sowie der Geschichte des polnischen Antisemitismus vor und nach dem Zweiten Weltkrieg geforscht.
Das Institut stieß zahlreiche Forschungsprojekte an, darunter eines zur Geschichte des jüdischen „Scheunenviertels“ im Berlin der Zwischenkriegszeit. Pickhan und andere Mitarbeiter des Instituts arbeiteten mit Forschungsstellen und Historikern in Polen sowie mit dem NS-Dokumentationszentrum Zwangsarbeit zusammen.
Das Institut hat eine Sommerschule in Jiddisch gesponsert, der Hauptsprache des osteuropäischen Judentums vor dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl jede ernsthafte Forschung zur osteuropäischen jüdischen Geschichte Kenntnisse des Jiddischen verlangt, gab es an deutschen Universitäten bis zur Gründung dieser Sommerschule keine Sprachschule dieser Art.
In den Jahren 2015-2017 bot das Osteuropa-Institut unter der Leitung von Gertrud Pickhan und Alina Bothe einen Kurs über die so genannte „Polenaktion“ im Oktober 1938 an, der ersten Massendeportation von Jüdinnen und Juden aus Nazi-Deutschland, in deren Rahmen Masterstudierende die Biographien von betroffenen Familien recherchierten.
Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts wurden in einem Ausstellungskatalog und einer Ausstellung zusammengestellt, die zunächst im Centrum Judaicum in Berlin und dem Jüdischen Historischen Institut in Warschau gezeigt wurde und bald auch in der deutsch-polnischen Grenzstadt Zbąszyń zu sehen sein wird, in der viele der Deportierten 1938-1939 zeitweise festsaßen. Es war das erste Forschungsprojet zur Polenaktion in Berlin, einer insgesamt wenig beleuchteten Episode in der Geschichte des Holocaust, und wurde mit minimalen finanziellen Mitteln vor allem dank der Initiative von Pickhan und Bothe und den Studierenden umgesetzt.
Professorin Pickhan nahm auch Stellung zum Geschichtsrevisionismus in Polen und stand für ihre prinzipiellen Arbeiten wiederholt im Kreuzfeuer der extremen Rechten und der polnischen staatlichen Medien. Die ultra-rechte Regierung der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ führt seit 2015 eine systematische Geschichtsfälschungskampagne und greift dabei Historiker an, die zur Geschichte des polnischen Antisemitismus und Holocaust forschen.
In Deutschland war ihre Forschung zweifellos den Kräften ein Dorn im Auge, die seit Jahrzehnten und vor allem seit 2014 systematisch an einer Legitimierung der Verbrechen des Nationalsozialismus arbeiten.
Im Februar 2014, im gleichen Monat, in dem Berlin und Washington einen rechten Putsch in Kiew unterstützten, veröffentliche der Spiegel ein Interview mit dem rechtsradikalen Humboldt-Professor Jörg Baberowski, in dem dieser erklärte, im Gegensatz zu Stalin sei Hitler „nicht grausam“ gewesen. Um deutlich zu machen, dass es ihm um eine vollständige Revision der Geschichte ging, betonte Baberowski: „Nolte wurde Unrecht getan. Er hatte historisch recht.“
Die Sozialistische Gleichheitspartei, die deutsche Sektion des Internationalen Komitees der Vierten Internationale, und ihre Jugendorganisation, die International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), waren damals die einzigen, die gegen diese rechten Positionen protestierten und vor ihren weitreichenden politischen Implikationen warnten.
Diese Warnungen haben sich bestätigt. In den vergangenen neun Jahren kam es nicht nur zu einem extremen Rechtsruck der gesamten bürgerlichen Politik und zum Aufstieg der rechtsextremen AfD, sondern auch zu einer systematischen Wiederbelebung des deutschen Militarismus. Im Februar 2022 nutzte die deutsche Bourgeoisie den russischen Angriff auf die Ukraine, um das umfassendste Rüstungsprogramm seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Gang zu setzen.
Die Rückkehr des deutschen Imperialismus zur offenen Kriegspolitik geht einher mit einem umfassenden Angriff auf die Geschichte und die Geschichtsforschung. Die Übernahme des Osteuropa-Institut durch den Baberowski-Zögling Kindler ist die bislang weitreichendste politische Konsequenz dieses Umschwungs an den Universitäten.
Die IYSSE und die WSWS haben seit 2014 Forscher und Historiker aufgefordert, dem rechten Geschichtsrevisionismus von Baberowski und Konsorten entgegenzutreten. Die Entwicklungen am Osteuropa-Institut unterstreichen, dass es dafür höchste Zeit ist. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Zukunft der Geschichtswissenschaften und der Holocaust-Forschung. Wenn es nach der deutschen Bourgeoisie und ihren Helfern in der Professorenschaft ginge, würde an deutschen Universitäten nur noch die „Geschichte“ gelehrt, die den Interessen des deutschen Imperialismus und seiner Kriegspolitik dient.
Die Zerschlagung des Lehrstuhls von Professorin Pickhan ist von vielen Historikern und Studierenden zweifellos mit großer Verstörung wahrgenommen worden. Doch es ist nun Zeit zu handeln. Wir rufen Studierende und Historiker auf, sich diesem Angriff auf die Holocaust-Forschung und dem Geschichtsrevisionismus der extremen Rechten, der nun offen vom Staat gefördert wird, entgegenzustellen und Kontakt mit der WSWS und der IYSSE aufzunehmen.