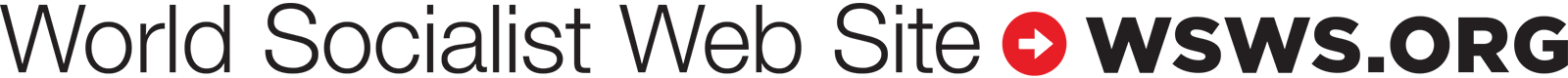Der Film „Das Deutsche Volk“ von Marcin Wierzchowski war ein Höhepunkt der diesjährigen Berlinale. Zum fünften Jahrestag des rechtsextremen Anschlags in der Arbeiterstadt Hanau mit neun Toten zeigt diese Dokumentation eindrucksvoll den Kampf der Hinterbliebenen und ihrer Unterstützer gegen Rassismus im Polizei- und Sicherheitsapparat und die Weigerung der Behörden dagegen vorzugehen.
Der Titel des Films nimmt auf das Denkmal für die Brüder Grimm Bezug, das auf dem Marktplatz in Hanau steht und die Inschrift trägt „Das Deutsche Volk“. Die aus Hanau stammenden Grimm-Brüder hatten sich in der Revolution 1848 engagiert und Jakob Grimm hatte in der Frankfurter Nationalversammlung, die in der Paulskirche tagte, einen Antrag zum Ersten Artikel der Grundrechte eingebracht.
Wie viele andere fortschrittliche Initiativen wurde damals der Antrag mit dem Wortlaut „Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien, und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei“ abgelehnt. Doch im aufsteigenden Bürgertum und in der Bevölkerung hatten die Gebrüder Grimm große Unterstützer.
An diesem – und keinem anderen Ort – wollten die Hinterbliebenen des Anschlags vom 19. Februar 2020 ein Denkmal gegen Rassismus errichteten und an die Toten erinnern, doch die Behörde lehnt ab und weigert sich.
An jenem 19. Februar vor fünf Jahren hatte der 43-jährige Rechtsextremist Tobias Rathjen neun junge Menschen aus seiner Nachbarschaft wahllos erschossen und sechs weitere Menschen teils schwer verletzt, ehe er seine Mutter und sich selbst tötete.
Die Toten waren überwiegend junge Arbeiter und eine alleinerziehende Mutter zweier Kinder, die meisten geboren und aufgewachsen in Hanau und Umgebung. Ihre Familien kamen teilweise vor langer Zeit aus dem ehemaligen Jugoslawien, Türkei, Rumänien, Bulgarien, Afghanistan. Drei gehörten der Roma-Minderheit an, die einst von den Nazis verfolgt und ermordet wurde.
Sechs Tage vor der Tat hatte der behördlich bekannte Rathjen, ein diplomierter Betriebswirt, der als Ausländer-, Islam- und Judenhasser bekannt war, legal mehrere Waffen besaß und regelmäßige Schießtrainings absolvierte, auf seiner Website ein Dokument mit nationalsozialistischen Vernichtungsphantasien eingestellt und seine Mordabsicht quasi angekündigt.
Von Anfang an macht der Film deutlich: Es handelte sich nicht um einen psychopathischen Einzeltäter, wie Polizei, Staatsanwalt, Politiker und Medien behaupten, oder gar um rassistische Auffassungen, die angeblich aus der so genannten einfachen Bevölkerung kommen. Der Mörder handelte unter den Augen des Staats und der Politik, die systematisch ausländerfeindliche Stimmungen schürt. Es war „behördlicher Rassismus“, wie es ein betroffener Vater im Film nennt.
„Wir sind wütend gegen die rechte Stimmungsmache, die solche Taten möglich macht“, rufen junge Leute bei der ersten spontanen Demonstration 2020, ein junges Mädchen, das sich beteiligt, verweist vor der Kamera auf den Rassismus der Polizei. Kurz nach den Morden macht die Nachricht die Runde, dass die zu dieser Zeit in der Gegend eingesetzte SEK-Einheit von Neonazis durchsetzt ist. Die hessische Regierung ist gezwungen, die Einheit aufzulösen.
Die Hauptpersonen des Films sind die Angehörigen der Toten, ihre Freunde und Kollegen aus Hanau, die eine Initiative gründen, um die Tat aufzuklären und ein Denkmal für die Toten zu fordern. Sie erkämpfen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der letztlich enthüllt, dass die Behörden und Polizei entscheidend zum Tod der jungen Menschen beigetragen haben.
Das Notruf-Telefon der Polizei wurde in dieser Nacht nicht abgenommen, und später fanden die Angehörigen mit Hilfe von Anwälten und dem britischen Recherchekollektiv Forensic Architecture heraus, dass der Notausgang der Arena Bar, in dem die meisten Menschen starben, vermutlich durch die Polizei verschlossen worden war.
Eine ruhige Kameraführung, nüchterne Schwarzweiß-Aufnahmen, überraschende Schnitte und kontrastierende Szenenwechsel, Audio- und Videoeinspielungen von Politikeransprachen, Gedenkmessen, Kundgebungen und immer wieder die Familien und die Freunde der Toten, mit Gesichtern gezeichnet vom Entsetzen, Unverständnis und Leiden, die ihre Erinnerungen, Gedanken und Erklärungsversuche ausdrücken – auf der Leinwand entfaltet der Film eine Wirklichkeit, die den Zuschauer unwiderstehlich in ihren Sog zieht.
Schon der Beginn lässt aufhorchen: Rufe auf einer Kundgebung, mit den Namen der Toten, dann bricht das Stimmengewirr ab – in der plötzlichen Stille hört man nur noch Schleifgeräusche. Auf einem weißen Marmorstein taucht ein Arbeiter auf, es ist Vili-Viorels Vater Niculescu Păun. „Granit, das ist Granit aus Italien“, ruft er und klopft auf den Stein. „Dies ist für mein Herz, für meinen Sohn“. Die Kamera schwenkt höher, man sieht eine Art Mausoleum auf einem Friedhof, mit den Fotos von Vili-Viorel und den anderen Toten auf der äußeren Wand befestigt.
Während Vili-Viorels Vater weiter den Stein behaut, hört man die Funksprüche jener Nacht: „Wieviele Tote am Heumarkt, also fünf bis jetzt?“ Danach eine Ansprache von Bundespräsident Steinmeier, der mit gespielter Anteilnahme erklärt, die Tat sei „ein Angriff auf uns alle“; doch gebe es auch Widerspruch zu dieser Auffassung und Menschen, die meinen, es gelte „nicht uns“, mit weißer Haut und Herkunft aus Westfalen oder Breslau, sondern „den Dunkelhäutigen, Dunkelhaarigen“, die als „Fremde“ gelten.
Später sagt die türkische Mutter von Sedat Gürbüz, sie habe sich lange nicht als Fremde gefühlt. Ihr 29 Jahre alter Sohn, erzählt sie, ist in Langen geboren und in Dietzenbach aufgewachsen. Während sie sein Handy auflädt, ergänzt sie: „Er war stolz auf sich, wollte immer selbstständig werden, wollte Boss sein.“ Die Shisha-Bar, in der er Geschäftsführer war, war einer der Tatorte; dort starb er.
Vili-Viorel, ein Roma aus Rumänien und das einzige Kind seiner Eltern, war 2013 als 16-jähriger nach Deutschland gekommen, um Geld für eine medizinische Behandlung seiner Mutter zu verdienen. Er arbeitete als Kurierfahrer und versuchte in der Tatnacht, mit seinem Auto den Täter zu stoppen, bis dieser ihn durch die Frontscheibe erschoss. Zuvor hatte er viermal den Notruf der Polizei angerufen, bei dem niemand abnahm.
Später heißt es von der Polizeibehörde entschuldigend, es habe an dem Tag nur ein Notruf-Platz in Hanau gegeben, es gebe hier Modernisierungsbedarf.
Sein Vater hält das Handy in die Kamera: Er habe seinen Sohn ständig zu kontaktieren versucht, als er im Radio von einer Schießerei gehört hatte. Erst 18 Stunden nach der Tat, als er schon bei der Arbeit war, wurden er und seine Frau informiert. Dasselbe erzählt der Vater des 22jährigen Hamza Kurtović, der gerade eine Ausbildung als Fachlagerist abgeschlossen hatte. Die Familie war vor vielen Jahren aus dem bosnischen Teil Jugoslawiens eingewandert.
Erst am nächsten Tag erhielten sie plötzlich eine Nachricht mit der Aufforderung, die Leiche zu identifizieren und zu waschen, falls es ihr Sohn sei. Von der Obduktion erfahren sie erst im Nachhinein. Sie war ohne ihre Zustimmung angeordnet worden. (Mehrere Familien, wie die von Gökhan Gültekin, mussten fünf Tage warten, ehe sie die Leiche zurückbekamen.)
Hamzas Vater Armin Kurtović empört sich: „Im Bericht stand, es sei ein Toter mit ‚orientalisch südländischem‘ Aussehen.“ Er zeigt das Foto seines Sohnes, das einen sehr deutsch aussehenden blonden Jungen zeigt, „mit blauen Augen“, wie der Vater betont.
Diese Anspielung auf die Nazi-Ideologie von der arischen Rasse wiederholt auch Vili-Viorels Vater drei Jahre später. Er ist zurück nach Rumänien gezogen, die Familie hat wieder ein Kind bekommen. Nach der Taufe in einer rumänisch-orthodoxen Kirche streichelt er sein Baby und sagt: „Jetzt habe ich wieder einen Sohn. Er wird blond sein und blaue Augen haben, nicht wie mein armer Vili-Viorel“.
Der Regisseur zeigt die betroffenen Familien ohne Beschönigung, auch ihre Religiosität, ihre Gebete. Eine Szene beginnt mit einer Trauerfeier in der orthodoxen Kirche. Der Priester segnet die Angehörigen, dann plötzlich ein scharfer Schnitt und ein junger Boxer, der eine Minute lang über die ganze Leinwand hinweg nach links und nach rechts boxt. Dem Beten folgt der Kampf!
Es ist ein Freund von Vili Viorel und anderen, die in der Arena Bar waren. Er selbst hat hinter dem Tresen sein Leben gerettet. Nach dem Training sitzt er vor dem Fitness-Eingang und wiederholt fast ungläubig immer wieder dieselben Sätze. Er habe dies in seinem bisherigen Leben noch nie erlebt, erst hat er Spaß mit seinen Freunden in der Bar und plötzlich sind drei seiner Freunde tot. „Ich kann es nicht glauben, drei Freunde tot, und ich werfe Erde auf ihren Sarg!“
Diese bittere Erfahrung verbindet sich zunehmend mit dem Verlust der Illusionen in die Politik. Trotz parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der zunächst auch von der SPD befürwortet wird, stoßen die Freunde und Angehörigen der Toten in der Frage eines Mahnmals auf dem Marktplatz, dem Ort des Grimme-Denkmals, auf wachsenden Widerstand auch der Oppositionsparteien.
Immer neue Entwürfe für ein solches Denkmal auf dem Marktplatz werden vom Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky, SPD, mit dem Hinweis abgelehnt, man habe anonym Kritik aus der Bevölkerung gegen ein solches Vorhaben erhalten. Man könne höchstens etwas an einem anderen Platz installieren. In einer Anhörung mit den Stadtverordneten und dem Oberbürgermeister kommt es zum heftigen Schlagabtausch. Çetin Gültekin, Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin, betont, dass entweder das Denkmal auf dem Marktplatz stehen muss oder dass die Angehörigen lieber darauf verzichten.
Er wendet sich gegen die feige Begründung, es habe angeblich Briefe aus der Bevölkerung gegen diesen Standort gegeben. „An anderen Orten rennen die Leute vorbei. Dann lieber gar kein Denkmal“, sagt er. Es sei wichtig für die ganze Gesellschaft, „die Leute jeden Tag damit zu konfrontieren“, was passiert ist.
Sedats Mutter Emiş Gürbüz verweist darauf, dass sich ihr Sohn immer auf dem Marktplatz mit seinen Freunden getroffen habe. Erregt bringt sie ihren Hass auf die Politiker und den Oberbürgermeister zum Ausdruck, der die Angehörigen immer nur hingehalten habe.
Darauf Kaminsky im beleidigten Ton, er müsse „jetzt schlucken“. Frau Gürbüz habe schon eine Woche zuvor bei einem Treffen mit dem Kanzler gerufen, sie „hasse Deutschland und alle Deutschen“. Sedats Mutter unterbricht ihn empört: „Ich habe gesagt, Deutschland, aber nicht die Deutschen.“
Bei einer späteren Kundgebung bringt Niculescu Păun, Vili-Viorels Vater, ihre Erfahrung mit der Politik folgendermaßen auf den Punkt: „Früher gab es schon Skinheads mit Bomberjacken und Springerstiefeln. Heute jedoch sitzen die Neonazis mit Krawatte und Anzug im Parlament! Ihr pflegt sie, schützt sie. ... Ihr sagt, Mölln darf es nicht mehr geben, Hanau darf es nicht mehr geben, aber es wird immer wieder passieren, wenn nicht grundlegend Konsequenzen gezogen werden.“
„Das Deutsche Volk“ ist ein bemerkenswerter Film, der sich ernsthaft und zugleich künstlerisch einfühlsam um die Wahrheit bemüht. Er liefert einen Gegenpol zur gegenwärtigen rechten Hetze gegen Migranten und Flüchtlinge, die im deutschen Wahlkampf neue Dimensionen angenommen hat.