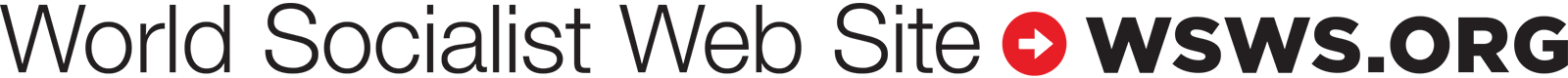Seit Februar 2023 lief im Dresdner Staatsschauspiel die Bühnenfassung des Romans „Vaterland“ (original: Fatherland) von Robert Harris. Am 22. Mai wurde es ein letztes Mal aufgeführt. Unter der Regie von Claudia Bauer verliert sich ein mitreißendes wie hochaktuelles Stück jedoch in unnötigen Albernheiten und Effekthaschereien.
Harris Roman von 1992 versetzt den Leser in eine dystopische Parallelwelt, die Historisches mit Fiktivem verknüpft. Wir schreiben das Jahr 1964, und US-Präsident Joseph P. Kennedy steht kurz davor, das führende Staatsoberhaupt Europas zu treffen. Es handelt sich dabei aber weder um den französischen Präsidenten, den britischen Premier oder den Kommissionspräsidenten einer vorzeitigen EU, sondern um den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler.
Nazi-Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg zumindest in Europa gewonnen. Das Dritte Reich erstreckt sich bis an den Ural und führt dort seit Jahrzehnten einen festgefahrenen Abnutzungskrieg gegen die Reste der Sowjetunion. Die USA wiederum haben zwar Japan besiegt, sich aber nach der Kapitulation Großbritanniens aus Europa zurückgezogen und führen nur noch einen Kalten Krieg gegen dieses „Großdeutsche Reich“.
Zum 75. Geburtstag des Führers soll nun dieser Kalte Krieg enden und mit dem US-amerikanischen Präsidenten Joseph P. Kennedy ein Abkommen geschlossen werden, um die Beziehungen zu normalisieren.
Im Mittelpunkt der Handlung steht SS-Sturmbannführer und Kriminalkommissar Xaver März in Berlin. Der einstige U-Boot Kapitän und geschiedene Vater eines Sohnes wird als nachdenklicher Einzelgänger geschildert. Als gewissenhafter Ermittler bekommt er es mit einem Todesfall zu tun, der auf persönliches Drängen des Gestapo-Chefs Odilo „Globus“ Globocnik als Selbstmord abgeheftet werden soll.
Doch der vermeintliche Suizid des pensionierten Staatssekretärs Josef Bühler „stellt sich schnell als ein Verbrechen mit politischer Tragweite heraus. Gemeinsam mit der amerikanischen Journalistin Charlotte Maguire stößt März bei seinen Nachforschungen auf ein in dieser fiktiven ‚Version der Geschichte‘ bislang vertuschtes, kaum vorstellbares Verbrechen“, fasst das Staatsschauspiel den Kern der Handlung zusammen. Dieses Verbrechen ist natürlich der Holocaust.
Erschienen 1992, avancierte der Roman schnell zum internationalen Bestseller. In den deutschen Zeitungsfeuilletons jedoch wurde er verrissen. Ein Blick auf das Buchcover der Erstausgabe offenbart bereits, warum.
Der britische Autor Robert Harris schrieb unter dem Eindruck der Wiedervereinigung und den Warnungen vor einem Wiederaufstieg der deutschen Großmacht.
„Er insinuiert, Kanzler Kohl habe die von den Nazis angestrebte wirtschaftliche Herrschaft über Europa vollendet“, fasste Karl-Heinz Janßen damals für Die Zeit zusammen, was deutsche Feuilletons Harris‘ Roman rundherum übelnahmen: Nach der Wiedervereinigung und Kohls „geistig-moralischer Wende“ wagte es dieser Brite, in die neue großdeutsche Suppe zu spucken, in dem er aufzeigt, wie deutsche Eliten den Holocaust vertuschen und sich die US-Außenpolitik daran nicht sonderlich stört. Aber „wenigstens hat sich kein deutscher Verleger für solch frivole Geschmacklosigkeit hergegeben“, triumphierte Janßen in der Zeit.
Tatsächlich erschien „Vaterland“ auf Deutsch zunächst nur in der Schweiz und erst 1994 auch im deutschen Heyne Verlag. Dass die damaligen Befürchtungen keine Fiktion oder „frivolen Geschmacklosigkeiten“ waren, zeigt die Entwicklung seit der Wiedervereinigung und die gegenwärtige Situation. In der Tat leiteten die 90er Jahre den Aufstieg des deutschen Imperialismus zur führenden Macht in Europa ein. Die Osterweiterung, die heutige militärische Aufrüstung und Drohung gegen Russland lassen Krieg und Diktatur wieder zurückkehren.
Die Bühneninszenierung von „Vaterland“ durch Claudia Bauer tritt Versuchen entgegen, die Nazi-Vergangenheit zu vertuschen und zu verharmlosen. Nach einem kurzen Einstieg über die welthistorische Lage findet sich der Zuschauer beim Rundgang einer Touristengruppe wieder. Berlin war mittlerweile gemäß den Fantasien von Hitler in die „Welthauptstadt Germania“ umgebaut worden, und über der Stadt thront nicht der Fernsehturm, sondern die 320 Meter große „Ruhmeshalle“.
In der Gruppe tragen alle unterschiedliche, grell farbige, jedoch typgleiche Jogginganzüge und zugleich Gesichtsmasken mit blonder Perücke. Eine gelungene Parodie auf das lächerliche Schönheitsideal der „arischen Rasse“ und die uniformierte Gesellschaft.
Mit in der Gruppe ist Xaver März, gespielt von Nadja Stübiger, und sein Sohn Paul, gespielt von Kaya Loewe. In Zwiegesprächen erhält man einen Eindruck vom angespannten Familienverhältnis zwischen dem indoktrinierten Sohn und dem zynischen, wenn nicht gar gelangweilten Vater angesichts einiger Ungereimtheiten bei den offiziellen Darstellungen der Stadtführerin. Die Stadtführerin, gespielt von Ahmad Mesgarha, stellt sich als „Dirk ausm Bezirk“ vor. Mit Berliner Dialekt als auch Schnauze und hier und da gestreuten grotesk-lächerlichen „Führerweisheiten“ führt er bzw. sie durch die Stadt und rattert routiniert Zahlen und Fakten zur Stadtarchitektur herunter.
Darauf beschränkt wäre es eine gelungene Darstellung der absurden Realität in „Germania“. Doch Claudia Bauer und ihr Team lassen das Absurde ins Seichte abgleiten. Und so parodiert Ahmad Mesgarha seine Rolle im kurzen Rock als eine Mischung aus Stadtführerin und Stewardess mit übertrieben ausgreifenden Gesten, Slapstick-Einlagen, Gesang und mehrfachen Wortwitzen.
Bereits diese Anfangsszene ist symptomatisch für eine Kernproblem der ganzen Aufführung. Statt durch dosierte Überzeichnungen die grotesken Verhältnisse in der Nazi-Dystopie zu veranschaulichen, verliert sich das Stück in nutzlosen Albernheiten. So wird der Zuschauer immer wieder aus der bedrohlichen und abstoßenden Atmosphäre in „Großdeutschland“ und der dramatischen Krimi-Handlung herausgerissen.
Weitere Beispiele sind die Szenen, in denen Xaver März und Kripo-Kollege Jäger mit einer Pralinenschachtel herumalbern, oder Journalistin Maguire vier Gestapo-Schergen mit einem Baseballschläger verdrischt, musikalisch untermalt wie aus Zeichentrickfilmen, oder wenn März und Maguire während eines Dialoges über die Hintergründe des Todesfalls in rosa bzw. weißem Petticoat auf der Bühne wie Ballerinen herumtanzen.
Gerade die verschiedensten Nebenrollen, die Ahmad Mesgarha ausfüllt, stechen dabei negativ hervor. Nach der Pause wird aus dieser „Nazi-Comedy“, wie es ein Redakteur des Deutschlandfunks formulierte, „plötzlich expressives Theater mit rollenden Augen, lautem Gebrüll und einer unnötig blutigen Folterszene“.
Es ist den starken Leistungen der Schauspieler, allen voran von Nadja Stübiger, aber auch dem gelungenen Bühnenbild zu verdanken, dass der Zuschauer immer wieder in die eigentliche, die bedrohliche, bedrückende und düstere Atmosphäre zurückgeholt wird.
Die Bühne wird im Wesentlichen durch einen monolithischen, dunklen Holzquader ausgefüllt. Dieser dient mit Türen und Fenstern mal als Kulisse, mal als Hintergrund, aber überwiegend als „schwarzes Loch, in das März immer wieder reingesogen wird“ und sich entscheiden muss: „Geh ich da rein?“ Oder wie Claudia Bauer im Interview sagt: „Das faulige Zentrum des Universums, in dem wir uns in Vaterland bewegen, ist natürlich der verschwiegene Holocaust.“
In dieses „faulige Zentrum“ wird der Zuschauer maßgeblich durch eine Handkamera mitgenommen, die live auf einer Leinwand zeigt, was sich im Inneren abspielt. Diese Kamera wird jedoch auch an anderer Stelle immer wieder erfolgreich genutzt, um die Szenerie zu verdeutlichen oder dem Mimen-Spiel der Schauspieler mehr Raum zu geben.
Einer der Höhepunkte ist dabei zweifellos der Moment, als März und Maguire nach langer Suche die Dokumente in der Hand halten, die den Holocaust belegen. In der Dystopie der Romanvorlage fielen diesem über zehn Millionen Menschen zum Opfer, und die Spuren, einschließlich aller Vernichtungslager wurden bereits beseitigt. Mit dem einstigen Unterstaatssekretär Martin Luther wurde auch der letzte Teilnehmer der Wannsee Konferenz, und somit Kronzeuge der „Endlösung“, vor ihren Augen erschossen. Mit den Dokumenten, die er ihnen noch übergab, halten sie nun die Büchse der Pandora in den Händen.
Abwechselnd lesen März und Maguire nun die Dokumente vor, während die Live-Kamera ihre Gesichter auf die Leinwand projiziert. Da ihre Worte vorher aufgezeichnet wurden, stehen ihre stummen Blicke des Entsetzens im Fokus. Während die innere Stimme von Maguire die im nüchternen Bürokratendeutsch verfassten Dokumente zur Endlösung vorliest, liest März im Wechselspiel aus Augenzeugenberichten vor. Angefangen von der Selektion an der Bahnrampe bis hin zum Hämmern an den Türen der Gaskammern wird der Zuschauer in einer kurzen Szene unglaublich eindrucksvoll in die ganze Tiefe des Grauens geführt.
Doch kurz darauf wird all das schon wieder zunichte gemacht. Maguire rezitiert in rasantem Tempo ein Gedanken-Stakkato über Wahrheit, faktische Wahrheit und wie man diese erkennen kann.
Im Interview mit Dramaturg Lüder Wilcke antwortet die Regisseurin auf die Frage, „wie man über das Unvorstellbare sprechen kann“, mit Verweis auf den slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, ein besonders zynischer Vertreter der Postmoderne und einstiger Stalin-Anhänger. Er habe in seinem Pamphlet „Beschreibung ohne Ort“ gesagt, man könne über den Holocaust sprechen, aber eher in einer lyrischen Form – „also eben nicht durch das Vorlesen von Dokumenten, ... auch nicht durch das prosaische Beschreiben, sondern eigentlich nur indirekt – so wie wir es tun – oder eben durch Lyrik.“
Es gehe im Stück um Propaganda, darum, „wie sich ein Staat darstellt“, und damit auch „um allgemeine Prinzipien totalitärer Regime“. In jeder Szene sei dies präsent, „Wahrheit und Propaganda. Oder Unwahrheit und Propaganda.“
Die postmoderne Auffassung, dass es keine erkennbare, objektive historische Wahrheit gebe und viele Wahrheiten gleichberechtigt nebeneinander existieren, letztlich auch die von Faschisten, hat seit der Auflösung der Sowjetunion zunehmend das kulturelle Klima vergiftet. Viele ehemals linke Intellektuelle verwandelten sich in Rechte, in Nato- und Kriegsbefürworter. Dazu gehört auch Slavoj Žižek, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs glühender Befürworter von Waffenlieferungen bis hin zur Atombombe für das rechte Selensky-Regime ist und Russland mit Hitler-Deutschland gleichsetzt.
So weit will Claudia Bauer nicht gehen, wie sie im Interview betont. Sie will auf keinen Fall „Parallelen zwischen Russland und diesem Großdeutschen Reich“ ziehen, sagt sie auf eine entsprechende Frage zum Ukraine-Krieg. Der Roman „Vaterland“ spiele durch, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Diktatur bedeute „Überwachung, Ausgrenzung, Vertuschung, im schlimmsten Falle Völkermord. Daran muss man erinnern“, fügt sie hinzu. Auch wenn die Darstellung des Holocaust im Theater eine „extrem heikle Angelegenheit“ sei, lohne es sich, über eine „spannungsgeladene Geschichte“ jüngere Generationen an das Thema heranzuführen.
Dass Claudia Bauer nicht in den Chor der postmodernen Kriegsbefürworter einstimmt, ist zu begrüßen. Doch ihre Orientierung an Žižek und der Philosophie der „vielen Wahrheiten“ hat zur Folge, dass sie einer grundlegenden Tatsache ausweicht: Das kapitalistische System, das in den 1930er Jahren den Faschismus hervorgebracht hat, existiert nach wie vor und treibt heute erneut zu Krieg, Diktatur und Völkermord. Die Postmoderne leugnet diesen inneren Zusammenhang.
Dies liegt auch der ambivalenten Inszenierung von „Vaterland“ zugrunde, seine irritierende Kombination von aufwühlenden Szenen zum Holocaust mit oberflächlicher Comic-Spielerei.
Diese Frage habe auch das Team belastet, gibt die Regisseurin zu. Sie habe Fragen aufgeworfen wie „Darf dieser Abend auch witzig sein? Inwieweit kann man da z.B. mit einer Sin City Ästhetik rangehen? Ist das nicht geschmacklos?“
Die letzte Aufführung des Stücks vergangene Woche endete – wie bereits die Aufführungen zuvor – vor einem vollen Haus und mit stehenden Ovationen für das Ensemble. Der große Erfolg ist nicht den Comic-Einlagen geschuldet, sondern der Aktualität und Brisanz der Geschichte für heute.